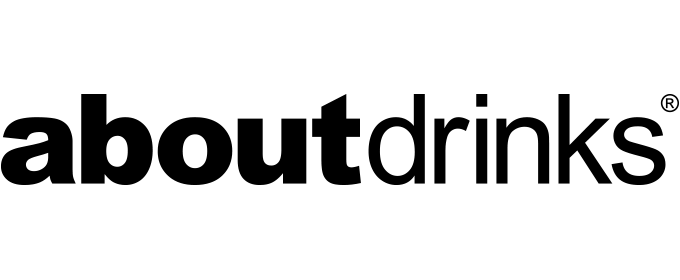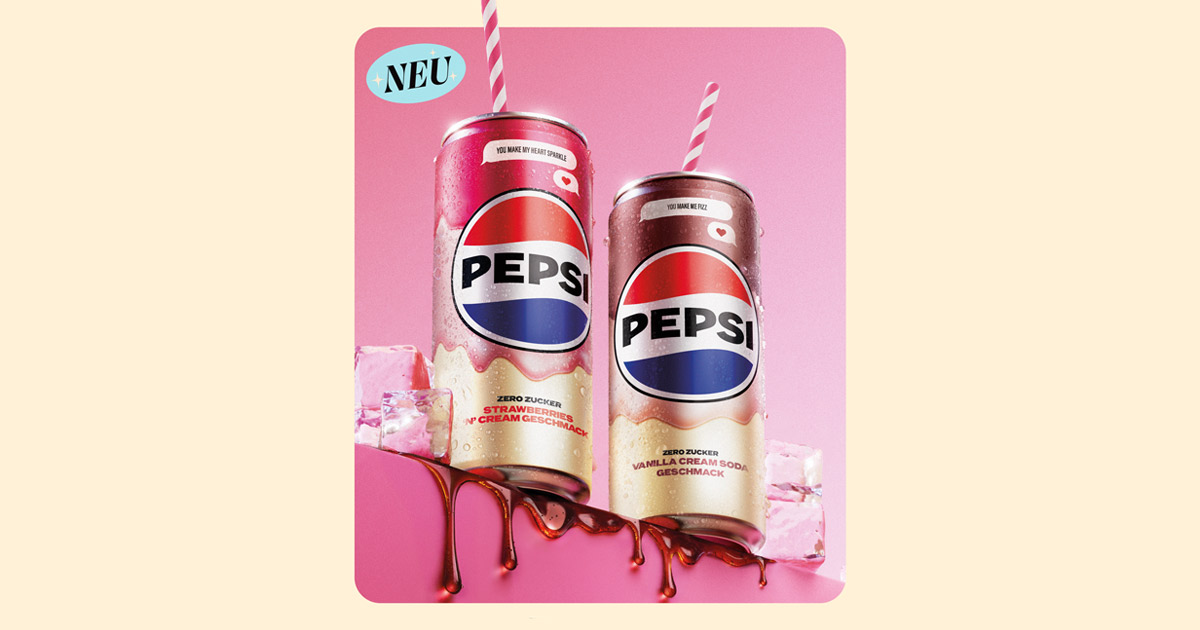Rechtsanwalt Dr. Christian Böhler: Gerichte sehen „alkoholfreie Spirituosen“ vermehrt als pfandpflichtig an
Bereits im Dezember 2023 hat sich der Autor an dieser Stelle mit der Frage befasst, ob „alkoholfreie Spirituosen“ pfandpflichtig sind. Anlass war seinerzeit eine Abmahnwelle des VSW, die zwischenzeitlich zu ersten Gerichtsentscheidungen geführt hat. Es ist daher erneut an der Zeit sich mit diesem Thema zu befassen.
Der Begriff des Getränks
Bereits im zuvor erwähnten Beitrag 2023 wurde die Frage diskutiert, ob die Einordnung einer alkoholfreien Alternative als „Getränkebasis“ oder „Getränkegrundstoff“ einen Ausweg aus der Pfandpflicht darstellen kann. Dieser derzeit immer noch in der Praxis beliebte „Kniff“ stößt indes auch bei den mit der Frage befassten Gerichten auf wenig Gegenliebe. Einzig das OLG München hat sich in seinem Urteil vom 28. November 2024 (Az.: 6 U 2305/24 e) etwas eingehender mit der Frage befasst, ob es sich bei „alkoholfreien Alternativen“ um Getränke im Sinne des Verpackungsgesetzes handelt und diese Frage eindeutig bejaht.
Für die Münchner Richter war allein entscheidend, ob eine Zweckbestimmung zum menschlichen Verzehr vorliegt. Hierbei seien sämtliche mit dem Erzeugnis in Verbindung stehenden Indizien heranzuziehen, aus denen sich Rückschlüsse auf die Zweckbestimmung ziehen lassen. Zu solchen Indizien zählen beispielsweise auch Werbeslogans oder sonstige Aussagen auf der Produktausstattung. Das OLG München sah in der Werbeauslobung „als alkoholfreie Alternative zu unserem Gin“ eine klare Zweckbestimmung als Getränk und bejahte somit auch die Getränkeeigenschaft im Sinne des Verpackungsgesetzes.
Das vom OLG München gefundene Urteil deckt sich auch mit dem zum Zollrecht angestellten Erwägungen. Hiernach ist von einem „Getränk“ auszugehen, wenn das Produkt „flüssig“ ist und eine objektive Eignung zum Verzehr aufweist. Hierbei kommt es nach Ansicht des BFH nicht darauf an, ob das Erzeugnis vorher aus geschmacklichen Überlegungen mit Wasser verdünnt werden sollte oder nicht. Ein Erzeugnis gilt nach Ansicht des BFH nur dann als nicht trinkbar, wenn es jedem Durchschnittsverbraucher unmöglich wäre, das Erzeugnis unmittelbar, ohne Verdünnung oder sonstige Beigabe zu trinken.
Auch unter diesen Voraussetzungen wird man kaum erfolgversprechend argumentieren können, dass es sich bei alkoholfreien Alternativen nicht um „Getränke im Sinne des Verpackungsgesetzes“ handelt, wenn diese zum menschlichen Verzehr bestimmt und geeignet sind. Einzig Erzeugnisse, deren unverdünnter Verzehr tatsächlich unmöglich (beispielsweise wegen Vergällung) oder rechtlich unzulässig wäre, wären aus dem Getränkebegriff auszunehmen. Hier gibt es Möglichkeiten, die aber eine produktbezogenen Beratung bedürfen.
Die bloße formale Bezeichnung als „Getränkegrundstoff“ führt nicht aus der Pfandpflicht
Sowohl nach der Rechtsprechung des OLG München als auch nach den zollrechtlichen Erwägungen und der überwiegenden Ansicht der Literatur führt die bloße formale Bezeichnung als „Getränkegrundstoff“ nicht aus der verpackungsrechtlichen Kategorie des Getränks heraus. Einzig das Abwasserrecht differenziert zwischen „Getränk“ und „Getränkegrundstoff“. Hier wird man allerdings bezweifeln können, ob der Gesetzgeber bei der Normierung abwasserrechtlicher Vorschriften die Ziele des Verpackungsgesetzes im Blick hatte; geschweige denn, auf diese Weise eine allgemein gültige Begriffsbestimmung vornehmen wollte.
Diesem hier zum Ausdruck kommenden Verständnis entspricht auch die Entscheidung des VG Stuttgart (Urt. v. 18.07.2024 – 14 K 1009/22). Das Gericht hob in Übereinstimmung mit dem VGH Baden-Württemberg (Az.: 10 S 1403/24) hervor, dass nicht die Vermarktung eines Getränks über die Frage entscheiden könne, ob das Produkt pfandpflichtig sei oder nicht; andernfalls wäre die Umgehung der Pfandpflicht, die der Gesetzgeber als Grundsatz verstanden haben möchte, viel zu leicht.
Ausnahmen von der Pfandpflicht
Bereits im Beitrag von 2023 wurde angerissen, dass § 31 VerpackG diverse Ausnahmeregelungen vorsieht, wonach bestimmte Verpackungsarten oder auch bestimmte Getränke nicht der grundsätzlichen Pfandpflicht unterliegen. Für den Fall der alkoholfreien Alternativen wäre eine Ausnahme über § 31 Abs. 4 S. 1 Nr. 7 lit.d) VerpackG denkbar. Nach vorbenannter Vorschrift sind Spirituosen und Produkte, die der Alkoholsteuer unterliegen, von der Pfandpflicht ausgenommen.
Mit Blick auf den Wortlaut der Vorschrift erscheint es zunächst abwegig, auch alkoholfreie Alternativen unter diese Ausnahme zu fassen, da es ihnen gerade am entscheidenden Merkmal, an das die Ausnahme von der Pfandpflicht anknüpft – nämlich dem Alkohol – fehlt. Die direkte Anwendung dieser Ausnahme dürfte mithin ausscheiden. § 31 Abs. 4 Nr. 7 VerpackG knüpft explizit an einen Mindestalkoholgehalt an, der von alkoholfreien Alternativen nicht erreicht wird.
Die Wortlautgrenze würde bei direkten Anwendung dieser Ausnahmevorschrift klar überschritten, weshalb nicht zu erwarten ist, dass sich auf diese Weise für die Produktkategorie eine Ausnahme erreichen lassen wird.
Analoge Anwendbarkeit von § 31 Abs. 4 S. 1 Nr. 7 lit.d) VerpackG
Möchte man die Wortlautgrenze überschreiten, so bleibt einem nach juristischen Maßstäben nur die Möglichkeit einer Analogie. Eine Analogie ist immer dann möglich, wenn eine planwidrige Regelungslücke besteht und die zu beurteilende Interessenlage mit der Interessenlage vergleichbar ist, die durch eine Ausnahme geregelt ist. Für eine solche analoge Anwendung lassen sich – auch wenn dies die Rechtsprechung bis dato noch nicht getan hat – durchaus Argumente finden.
Gerade mit Blick auf die Entstehungsgeschichte der Pfandpflicht wird man vorbringen können, dass im Jahr 2003 und auch in vielen Folgejahren noch niemand an alkoholfreie Alternativen gedacht hat. Diese Produktkategorie gab es – anders als beispielsweise alkoholfreien oder entalkoholisierten Wein – zum Zeitpunkt der Einführung der Pfandpflicht noch nicht.
Alkoholfreie Spirituosenalternativen sind gerade im Vergleich zu entalkoholisierten Weinbauerzeugnissen neue Produkte und es lässt sich durchaus argumentieren, dass der Gesetzgeber gerade diese Produkte bei der Schaffung der Ausnahmen nicht im Blick hatte. Hätte er sie zu diesem Zeitpunkt gekannt, erscheint es zumindest nicht vollkommen abwegig, dass er auch diesbezüglich über eine Ausnahme nachgedacht hätte.
Für eine analoge Anwendung lässt sich ferner anführen, dass der Gesetzgeber in der Gesetzesbegründung für die Pfandpflicht explizit festgehalten hat, dass diese auf „Massengetränke“ – wie „Bier, Mineralwasser und Erfrischungsgetränke mit oder ohne Kohlensäure“ – begrenzt sein soll, da „der ökonomische Aufwand eines Rücknahme- und Pfandsystems nur bei einem ausreichend hohen Marktanteil“ gerechtfertigt sei (BT-Drs. 15/4107, S. 2; BT-Drs. 15/4642, S. 2).
Nach damaliger Auffassung des Gesetzgebers bestünden bei Getränkesegmenten – wie Wein und Spirituosen – Besonderheiten, die bei der Abwägung des ökologischen Nutzens eines Pfandsystems im Vergleich zu den dadurch generierten ökonomischen Aufwendungen für die Etablierung eines Rücknahmesystems zu einem Missverhältnis führen würden, so dass die Einführung einer Pfandpflicht nicht zu rechtfertigen sei.
Viele dieser zuvor angestellten Überlegungen zu den Segmenten „Spirituosen“ und „Wein“ lassen sich auch für alkoholfreie Spirituosenalternativen ins Feld führen. Bei diesen Getränken wird man ebenfalls kaum von „Massengetränken“ reden können, sondern vielmehr von einer im Vergleich zu Spirituosen und Wein noch kleineren Nische. Ferner dürfte auch die Pfandpflicht für alkoholfreie Spirituosenalternativen mit erheblichen Kosten einhergehen, die für die Etablierung passende Rücknahmesysteme aufgewendet werden müssten.
Dies gilt natürlich alles unter dem Vorbehalt, dass der LEH überhaupt noch als Absatzmarkt für pfandpflichtige Spirituosenalternativen zur Verfügung steht. Hieran wird man bei Durchsetzung der Pfandpflicht für diese Produktkategorie wenigstens zweifeln dürfen.
Gegen eine Analogie der in § 31 Abs. 4 S. 1 Nr. 7 lit.d) VerpackG geregelten Ausnahmevorschrift spricht zunächst das bisher von der Rechtsprechung einhellig angeführte Argument, dass es sich um eine eng auszulegende Ausnahmevorschrift handelt. Zudem lässt sich anführen, dass alkoholfreie Spirituosenalternativen im Vergleich zu den von der Pfandpflicht ausgenommenen Spirituosen grundverschieden sind.
Kernvermarktungselement dieser Alternativprodukte ist gerade das Fehlen von Alkohol, welcher wiederum den Anknüpfungspunkt für die pfandrechtliche Ausnahme für Spirituosen bildet. Aber selbst wenn man auf eine gewisse Vergleichbarkeit der Marktsegmente abstellt, so wird man ebenfalls nicht gänzlich verneinen können, dass die Positionierung alkoholfreier Spirituosenalternativen in der Nähe des Marktsegments für Spirituosen im Wesentlichen auf eine entsprechende Vertriebs- und Marketingstrategie zurückzuführen ist.
Eben jene Strategien haben allerdings keinen Einfluss auf die rechtliche Kategorisierung eines Produktes. Vergleicht man die zugrunde liegenden Getränke, so muss man zu dem Ergebnis kommen, dass Spirituosen und alkoholfreie Spirituosenalternativen grundverschieden sind. Bei Spirituosenalternativen handelt es sich doch vielfach – stark vereinfacht und nicht despektierlich gemeint – um aromatisiertes Wasser mit Zusätzen.
Wenn allerdings Aromen – egal ob künstlich oder aus den nachgeahmten Originalen gewonnen – und Wasser die wesentlichen Komponenten des Getränks bilden, so erscheint es vorzugswürdiger, den Vergleich von alkoholfreien Spirituosenalternativen zu Near-Water-Getränken zu ziehen, anstatt diese mit über den Alkoholgehalt definierten Spirituosen zu vergleichen.
Zu bedenken ist im diesem Kontext ebenfalls, dass aktuelle Entwicklungen im Verpackungsrecht die Reduzierung von Verpackungsmüll immer weiter in den Fokus rücken und somit umweltpolitischen und abfallwirtschaftlichen Zielen Rechnung zu tragen ist. Angesichts dieser Perspektive erscheint es jedenfalls fragwürdig, ob ein Gericht eine analoge Anwendung von § 31 Abs. 4 S. 1 Nr. 7 lit.d) VerpackG tatsächlich in Erwägung ziehen würde.
Hilfe durch den Gesetzgeber
Wenn man nun – wonach es unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung aussieht – zu dem Ergebnis gelangt, dass es sich bei alkoholfreien Spirituosenalternativen, ungeachtet deren formeller Bezeichnung, um „Getränke“ im Sinne des Verpackungsgesetzes handelt und diese „Getränke“ weder der direkten Ausnahme für Spirituosen noch dieser Ausnahme in einer entsprechenden (analogen) Anwendung unterfallen, so kann nur eine Initiative des Gesetzgebers aus der Pfandpflicht für diese Produkte herausführen.
Betrachtet man – wie dargelegt – die seinerzeit vom Gesetzgeber angeführte Begründung für die Ausnahmen von „Wein“ und „Spirituosen“, so kann man durchaus zu dem Ergebnis gelangen, dass der ökologische Nutzen im Vergleich zu den ökonomischen Aufwendungen, die mit einer Pfandpflicht derartiger Produkte einhergingen, es nicht rechtfertigt, diese Produkte im Vergleich zu Spirituosen und/oder Wein einer Pfandpflicht zu unterwerfen.
Es ist daher zu begrüßen, dass Institutionen – wie der BSI – derzeit daran arbeiten, dass auch alkoholfreie Alternativen von der Pfandpflicht des Verpackungsgesetzes ausgenommen werden. Diese Initiative kann zwar als Silberstreif am Horizont für die betroffenen Hersteller gewertet werden, allerdings ist deren Ausgang ungewiss. Gewiss ist allerdings, dass das bloße Bemühen um eine künftige Ausnahme bei einer aktuellen Beanstandung nicht weiterhilft. Nach derzeitigem Stand der Rechtsprechung spricht vieles dafür, dass man aktuell davon ausgehen sollte, dass derartige Produkte pfandpflichtig sind.
Auch wenn derzeit keinerlei behördliche Beanstandungen wegen etwaiger Verstöße gegen die Pfandpflicht bekannt sind, so wird dies beispielsweise den VSW nicht im Geringsten daran hindern, auch künftig wegen Verstößen gegen die Pfandpflicht vorzugehen. Ganz im Gegenteil, die wachsende Zahl an Urteilen, die die Pfandpflicht alkoholfreier Spirituosenalternativen bestätigt, dürfte den VSW in seinem Vorgehen weiter bestärken, so dass hier das Beanstandungsrisiko auch für größere und namhaftere Hersteller weiter steigt.
Was nun?
Aus rechtlicher Sicht lassen sich – wie dargelegt – Argumente für und gegen eine Pfandpflicht finden. Die Rechtsprechung scheint derzeit überwiegend von einer Pfandpflicht dieser Produkte auszugehen. Bei näherer Betrachtung dieser Urteile muss man sich allerdings vor Augen führen, dass die hier von den Gerichten abgesetzte Begründung durchaus äußerst knapp, wenn überhaupt vorhanden, ausfällt und lediglich das OLG München etwas ausführlichere Erwägungen zu den relevanten Fragestellungen aufwirft. Sicherlich sind die vom OLG München gezogenen Schlussfolgerungen keineswegs zwingend und an verschiedener Stelle auch kritikwürdig. Dennoch dürfte von ihnen auch für andere Gerichte eine gewisse Signalwirkung ausgehen.
Was ist Herstellern von alkoholfreien Spirituosenalternativen also nun zu raten? Wichtig ist zunächst, dass sich jeder Hersteller, der ein solches Produkt im Sortiment hat, aktiv mit der Frage der Pfandpflicht befasst und einen Plan B und vielleicht auch einen Plan C entwickelt, die im Notfall verfolgt werden können, wenn es zu einer Beanstandung durch den VSW kommt. In dem Beitrag von 2023 ging es noch um Abmahnungen des VSW, die danach in ordentlichen Gerichtsverfahren geendet haben. Zwischenzeitlich ist der VSW dazu übergegangen, seine rechtlichen Ansprüche auch im Eilrechtsschutz durchzusetzen.
Das bedeutet, dass zwischen der Abmahnung durch den VSW und der vorläufigen Verurteilung des abgemahnten Unternehmens nur wenige Wochen liegen können. Das dann vom Gericht zwar nur vorläufig ausgesprochene Vertriebsverbot gilt dann allerdings ab sofort. Möchte man sicherstellen, dass man die eigene Argumentationslinie dahingehend verbessert, dass die eigenen Produkte nicht von der Pfandpflicht erfasst sind, so wird man sich die Mühe machen müssen, sich eingehender mit dem Verpackungsgesetz selbst und der stofflichen Zusammensetzung der verwendeten Verpackung und des darin enthaltenen Getränks zu befassen.
Es gibt durchaus Mittel und Wege, wie man sein Produkt so aufstellen kann, dass es auch unter der aktuellen Rechtsprechung sehr schwer werden dürfte, dieses Produkt als pfandpflichtig im Sinne des Verpackungsgesetzes einzustufen. Hersteller, die sich hier eingehend beraten lassen und Konzept entwickeln, könnten – wenn es zu einer großflächigen Pfandpflicht dieser Produkte kommt – einen erheblichen „First Mover Advantage“ haben, da damit zu rechnen ist, dass der Lebensmitteleinzelhandel pfandpflichtige Spirituosenalternativen im Sortiment wohl kaum akzeptieren dürfte.
Sicherlich ist bezüglich dieser Thematik noch nicht das letzte Wort gesprochen. Der Autor selbst begleitet verschiedene Mandanten in genau dieser Fragestellung und vertritt diese auch vor Gericht. Derzeit begleitet die Sozietät des Autors einen Mandanten in einem Verfahren vor der Zentralen Stelle Verpackungsregister, welche sich nun auch mit der Frage befassen muss, ob alkoholfreie Spirituosenalternativen als Getränk oder Getränkegrundstoff einzustufen sind, und ob sie etwaigen Ausnahmevorschriften nach § 31 VerpackG unterliegen. Sobald hier Neuigkeiten zu vermelden sind, wird es ein weiteres Update dieses Beitrags geben.
Über Christian Böhler
Dr. Christian Böhler ist Senior Associate in der International Dispute Resolution Praxisgruppe von Squire Patton Boggs (US) LLP in Frankfurt. Er hat sich auf die Bereiche Commercial und IP Litigation, Wettbewerbs- und Lebensmittelrecht spezialisiert. Sein Branchenfokus liegt auf Konsumgüterherstellern mit einem Schwerpunkt im Food&Drinks Sector. Christian Böhler berät zudem nationale und internationale Mandanten in Vertriebs- und Markenangelegenheiten, beim Aufbau von Marken, der Kennzeichnung von Produkten, sowie allen damit zusammenhängenden Rechtsstreitigkeiten.
Bild Dr. Christian Böhler: Copyright Aspose Pty Ltd.
Bild Spirituosen: ©iStockphoto | nikitos77